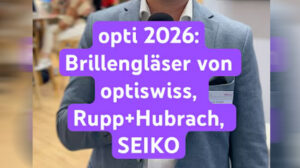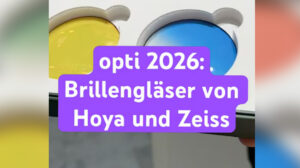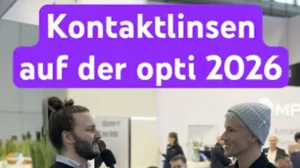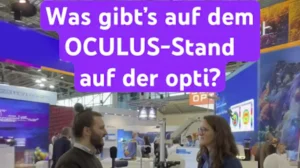Lange galt Kurzsichtigkeit als Thema, das erst dann relevant wird, wenn sie tatsächlich da ist. Doch in den letzten Jahren verschiebt sich der Fokus – weg von der reinen Korrektur hin zur Prävention. Das Stichwort lautet Prä-Myopie. Und wer in der Augenoptik tätig ist, sollte wissen: Dieses Thema hat das Potenzial, die Arbeit in der Praxis nachhaltig zu verändern.

Prä-Myopie – was ist das überhaupt?
Ein aktueller Schwerpunkt des Contact Lens Update, der vom Centre for Ocular Research & Education (CORE) herausgegeben wird, widmet sich genau dieser Phase, die man am besten als „Vorstufe der Kurzsichtigkeit“ bezeichnen kann. Prä-myop sind Kinder, die noch nicht kurzsichtig sind, bei denen aber mehrere Risikofaktoren zusammentreffen: eine geringe hyperope Reserve, intensives Nahsehen, wenig Zeit im Freien oder eine familiäre Vorbelastung.
Die Redaktion des Contact Lens Update macht deutlich, dass gerade diese Kinder in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen werden – und dass die Augenoptik entscheidend dazu beitragen kann, den Verlauf frühzeitig positiv zu beeinflussen.
Präventiv handeln, damit Myopie gar nicht erst entsteht
Ein Paradigmenwechsel deutet sich an. Statt zu warten, bis die Myopie manifest ist, rückt nun die Frage in den Vordergrund, wie sich die Entwicklung bremsen oder sogar verhindern lässt. Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit und Netzwerk-Metaanalyse, die im Oktober 2025 in Contact Lens Update vorgestellt wurde, liefert dazu spannende Ergebnisse. Sie fasst die bisherige Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener Myopiepräventionsmaßnahmen bei gefährdeten Kindern zusammen – und zeigt, dass einige Ansätze durchaus vielversprechend sind.
Rotlicht gegen Kurzsichtigkeit
Besonders deutlich wird dies beim wiederholten Einsatz von niedrig dosiertem Rotlicht. Studien belegen, dass Kinder, die regelmäßig einer solchen Lichttherapie ausgesetzt werden, über mehrere Monate hinweg eine langsamere axiale Augenlängenentwicklung zeigen als Kontrollgruppen.
In einer begleitenden Untersuchung wurde zudem ein Zusammenhang zwischen Veränderungen der Aderhautdicke und dem Behandlungserfolg festgestellt – was darauf hindeutet, dass physiologische Anpassungen der Aderhaut ein früher Indikator für den Therapieeffekt sein könnten. Das klingt technisch, hat aber praktische Relevanz: Wenn man versteht, wie die Aderhaut auf präventive Interventionen reagiert, lässt sich möglicherweise der richtige Zeitpunkt für die Behandlung besser bestimmen.
Auch pharmakologische Ansätze wie niedrig dosiertes Atropin zeigen in der Meta-Analyse eine deutliche Schutzwirkung, wenn auch in etwas geringerem Ausmaß. Hinzu kommen klassische Empfehlungen wie mehr Zeit im Freien, die zwar weniger starke, aber dennoch konsistente Effekte zeigen. Auffällig ist: Die Forschungslage verdichtet sich, und die Bandbreite der präventiven Maßnahmen wird breiter.
Prä-Myopie in der Augenoptik-Praxis
Die Prä-Myopie ist kein rein ärztliches Thema, sondern ein Bereich, in dem Beratung, Aufklärung und langfristige Betreuung eine ebenso große Rolle spielen wie medizinische Interventionen. Wer im Fachgeschäft regelmäßig Kinder und Eltern berät, kann frühzeitig aufmerksam machen – etwa, wenn bei der Refraktionsbestimmung eine niedrige Hyperopie auffällt oder wenn Eltern von langem Nahsehen am Tablet berichten.
Prä-Myopie hat seine Grenzen
Bei aller Euphorie über neue Erkenntnisse sollte man die Grenzen der derzeitigen Präventionsstrategien nicht verschweigen. Die meisten Studien stammen aus Ostasien, wo die Myopieprävalenz deutlich höher ist als in Europa. Ob sich die Ergebnisse eins zu eins übertragen lassen, ist offen. Auch langfristige Daten fehlen noch: Wie nachhaltig sind die Effekte von Rotlichttherapie oder niedrig dosiertem Atropin? Gibt es Rebound-Effekte, wenn die Behandlung beendet wird? Und wie gut lassen sich diese Maßnahmen in den Alltag westlicher Familien integrieren?
Solche Fragen sind entscheidend – gerade dann, wenn man das Thema in der täglichen Praxis kommunikativ aufgreifen möchte. Denn Eltern brauchen nicht nur Begeisterung für neue Methoden, sondern auch realistische Erwartungen. Weitere Informationen erhaltet Ihr hier.
- Glas-Neuheiten auf der opti 2026 – Teil 2: Und weitere Highlights - 5. Februar 2026
- Glas-Neuheiten auf der opti 2026 – Teil 1: Diese Neuheiten gabs - 5. Februar 2026
- Kontaktlinsen auf der opti 2026 – das waren die Neuheiten auf der TOMORROW VISION - 20. Januar 2026