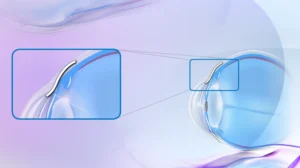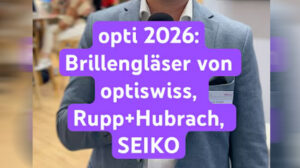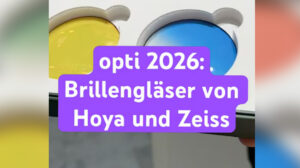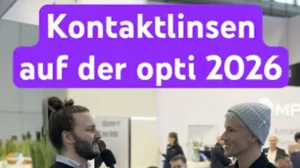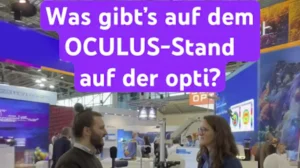Die Nutzung digitaler Bildschirme gehört längst zum beruflichen und privaten Alltag – sei es am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder unterwegs. Mit der zunehmenden Exposition gegenüber Bildschirmlicht rückt insbesondere kurzwelliges, sichtbares Blaulicht (etwa 400 bis 500 Nanometer) in den Fokus: Es steht im Verdacht, die Augen zu belasten und den Schlafrhythmus negativ zu beeinflussen. Doch wie relevant ist dieses Thema aus wissenschaftlicher Sicht – und was bedeutet es für die optische Fachberatung?

Blaulicht am Bildschirm: Gefahr für die Augen oder nur ein Mythos?
Blaulicht ist kein künstliches Phänomen – es kommt auch in Sonnenlicht in erheblichem Maß vor und ist für Menschen sogar biologisch notwendig, etwa zur Steuerung der inneren Uhr. Der Unterschied zur Bildschirmnutzung liegt jedoch in der Art und Weise der Exposition: Über Stunden hinweg und immer häufiger fixieren Nutzer leuchtende Displays und blinzeln dabei automatisch weniger. Häufig wird von Symptomen wie Augenbrennen, Trockenheit und schneller Ermüdung berichtet – Beschwerden, die auch in der augenoptischen Praxis immer häufiger thematisiert werden.
Aktuelle Studien machen jedoch deutlich: Für diese Symptome ist in erster Linie die Naharbeit selbst verantwortlich – nicht das Blaulicht an sich. Der reduzierte Lidschlag beim konzentrierten Blick auf einen Monitor führt zu verminderter Tränenfilmstabilität, während visuelle Ermüdung durch fehlende Pausen und einseitige Beanspruchung entsteht.
Wissenschaftlich belegt? Was Studien zur Auswirkung von Blaulicht wirklich zeigen
Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und anderen Fachquellen besteht bei normaler Nutzung von LED-basierten Displays kein erhöhtes Risiko für bleibende Augenschäden. Zellschädigende Effekte durch Blaulicht wurden bislang nur in Tiermodellen oder unter Laborbedingungen mit unrealistisch hoher Lichtintensität beobachtet. Für typische Alltagssituationen – ob bei Bildschirmarbeit oder im privaten Gebrauch – sind solche Szenarien nicht repräsentativ.
Zwar gibt es Hinweise darauf, dass Blaulicht in den Abendstunden die Melatoninproduktion hemmen kann, was den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst. Dieser Effekt ist jedoch individuell unterschiedlich ausgeprägt und nicht ausschließlich auf Bildschirmlicht zurückzuführen – auch Raumbeleuchtung oder das generelle Nutzungsverhalten spielen eine Rolle.
Blaulichtfilter in Brillen ohne nachweisbare Wirkung
Trotz anhaltender Nachfrage nach Blaulichtfiltergläsern bleibt die wissenschaftliche Bewertung zurückhaltend. Viele Anbieter werben mit positiven Effekten auf die Augen und den Schlaf – etwa durch Reduktion digitaler Ermüdung oder besseres Einschlafen am Abend. Doch die Evidenz für diese Versprechen ist begrenzt.
Wie wir berichteten, kommt eine systematische Übersichtsarbeit der University of Melbourne zu dem Schluss, dass Blaulichtfilter in Brillengläsern bislang keine nachweisbare Wirkung auf Symptome digitaler Augenbelastung oder auf die Schlafqualität zeigen. Die untersuchten Studien liefern uneinheitliche Ergebnisse, die keine klaren Empfehlungen zulassen. Auch der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) sieht keinen medizinischen Nutzen und empfiehlt einen differenzierten Umgang mit dem Thema. In der Praxis sollten solche Gläser eher als optionale Komfortlösung verstanden werden – nicht als medizinisch notwendige Maßnahme.
Nachtmodus & Blaulichtreduktion bei Displays: Subjektiver Komfort statt belegter Schutz
Viele digitale Endgeräte bieten heute systemseitige Funktionen zur Blaulichtreduktion – wie den Nachtmodus („Night Shift“, „Night Light“). Dabei wird die Farbtemperatur in wärmere Bereiche verschoben, was von vielen Nutzenden als angenehmer empfunden wird. Die subjektive Entlastung der Augen am Abend ist durchaus nachvollziehbar. Ob dadurch jedoch der Schlaf tatsächlich verbessert oder die Augen weniger belastet werden, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt.
Auch bei diesen Funktionen gilt: Sie können das Seherlebnis angenehmer gestalten, ersetzen aber keine ergonomischen Maßnahmen oder bewusste Pausen bei intensiver Bildschirmarbeit.
Wie schützt man die Augen bei langer Bildschirmarbeit?
Statt sich allein auf Filter oder technische Features zu verlassen, raten Fachleute zur Einhaltung etablierter Sehregeln bei Bildschirmarbeit. Die sogenannte 20-20-20-Regel – alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in rund 6 Metern (entspricht: 20 Fuß) Entfernung blicken – fördert die Entspannung der Augenmuskulatur. Auch ein bewusster Lidschlag, ausreichende Beleuchtung, ergonomisch angepasste Arbeitsplätze und regelmäßige Pausen tragen zur visuellen Entlastung bei.
Die Debatte um Blaulicht sollte weder dramatisiert noch bagatellisiert werden. Aktuell gibt es keine Hinweise auf bleibende Augenschäden durch Blaulicht aus typischen Bildschirmquellen. Gleichzeitig können individuelle Sehbeschwerden, Schlafprobleme oder visuelle Ermüdung im Zusammenhang mit der digitalen Lebensweise durchaus auftreten – allerdings multifaktoriell bedingt. Statt auf technische Lösungen allein zu setzen, empfiehlt daher ein ganzheitlicher Blick auf Bildschirmgewohnheiten, Ergonomie und Sehverhalten – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Kunden.
Studien:
Singh, S., Downie, L. E., & Anderson, A. J. (2023): “Blue‐light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults“
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (2023): “Stellungnahme Nr. 013/2023: LED-Lichtquellen können die Augen unter bestimmten Umständen schädigen”
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) & Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) (2018): “Stellungnahme der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, der Retinologischen Gesellschaft und des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands zu Brillen mit sogenannten Blaufiltern”
American Academy of Ophthalmology (AAO) (2024): “Computer Vision Syndrome & 20-20-20 Rule“
- Mehr Farben sehen als je zuvor? ColorBoost™ sichert sich EU-Patent - 12. Februar 2026
- Durchbruch bei gefürchteter Augenkrankheit: Trachom soll bis 2030 ausgerottet sein - 11. Februar 2026
- Oculus feiert Jubiläum: 15 Jahre Oculus Akademie - 10. Februar 2026