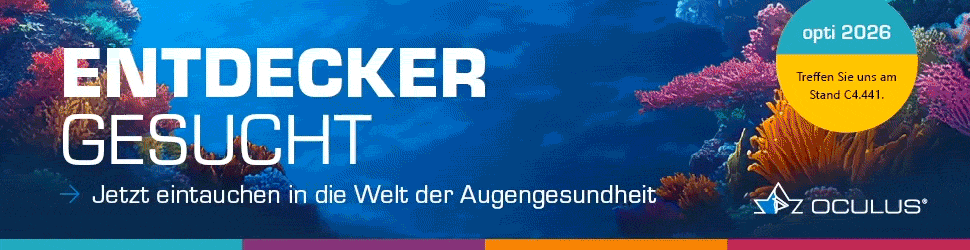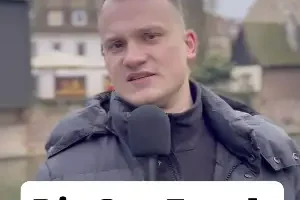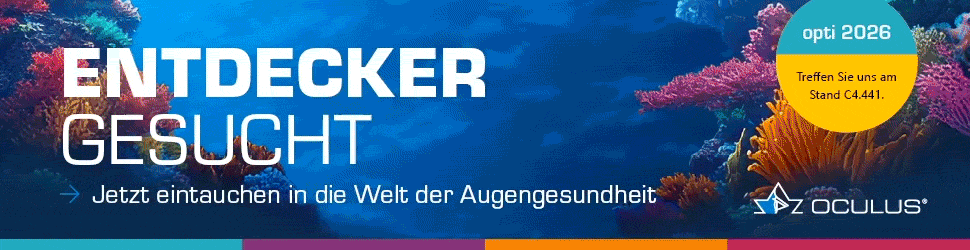Digitale Lösungen halten zunehmend auch in der Augenheilkunde Einzug. Besonders in Regionen, in denen Fachärzte nur begrenzt zur Verfügung stehen, könnten neue Geräte dazu beitragen, die Versorgung zu ergänzen und den Zugang zu augenmedizinischen Leistungen zu erleichtern. In Zörbig in Sachsen-Anhalt wird derzeit ein System erprobt, das genau diesen Ansatz verfolgt: Eyelib, ein telemedizinisches Gerät für augenärztliche Untersuchungen des Unternehmens MIKAJAKI.

Einordnung des Geräts Eyelib von MIKAJAKI

Das Unternehmen MIKAJAKI hat mit Eyelib eine Plattform entwickelt, die standardisierte Augenuntersuchungen ermöglicht. Patienten können dabei vor Ort bestimmte Tests durchführen, ohne dass ein Augenarzt direkt anwesend sein muss. Eyelib ist als robotisierte Untersuchungsstation konzipiert, die selbstständig eine umfassende Kontrolle der Augen vornimmt. Dabei werden Patienten zunächst über einen 3D-Ganzkörperscan und eine Gesichtsmorphometrie erfasst, um die optimale Position für die Untersuchung einzunehmen und die individuelle Ergonomie sicherzustellen.
Im Anschluss führt Eyelib mithilfe opto-elektronischer Geräte in wenigen Minuten hunderte verschiedene Messungen am Auge durch. Auf diese Weise wird ein vollständiges Bild des augenmedizinischen Status erstellt, das sowohl strukturelle Aufnahmen als auch funktionale Parameter umfasst. Die erhobenen objektiven Daten werden automatisch gespeichert und stehen anschließend für die ärztliche Auswertung zur Verfügung.
Die Ergebnisse werden zusammen mit den gesammelten Daten in einem sogenannten SmartVision Report zusammengeführt. Dieser Bericht bündelt mithilfe künstlicher Intelligenz das erhobene Messmaterial, sodass Ärzte an einem anderen Standort direkt einen strukturierten Überblick über den augenmedizinischen Befund erhalten.
Das Gerät ist bereits seit einiger Zeit verfügbar und wurde ursprünglich von MIKAJAKI konzipiert sowie in Zusammenarbeit mit Segula Technologies für den europäischen Markt technisch umgesetzt. Neu ist allerdings, dass es in Deutschland nun in einem konkreten Pilotprojekt praktisch an Patienten erprobt wird.
Telemedizinischer Ansatz bei augenärztlichen Untersuchungen
Der Einsatz von Eyelib ist Teil einer Entwicklung, die allgemein unter dem Begriff Telemedizin zusammengefasst wird. Ziel dabei ist, die medizinische Versorgung an Orten zu verbessern, an denen nur wenige Fachärzte verfügbar sind. Besonders im Bereich der Augenheilkunde kann es vorkommen, dass Patienten längere Wartezeiten oder weitere Wege in Kauf nehmen müssen.
Mit Eyelib können Untersuchungen vor Ort durchgeführt und die Ergebnisse digital weitergeleitet werden. Dadurch wird eine räumliche Trennung zwischen Untersuchung und ärztlicher Auswertung möglich. Das Ziel besteht nicht darin, die ärztliche Diagnose zu ersetzen, sondern deren Arbeitsabläufe zu unterstützen und die Reichweite der Versorgung zu erweitern.
Pilotprojekt in Zörbig: Eyelib im Testbetrieb
In Zörbig wird Eyelib derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt. Damit soll getestet werden, welche praktischen Vorteile das System im Alltag bietet, sowohl für die betreuenden Ärzte als auch für die Patienten. Im laufenden Testbetrieb werden erste Erfahrungen gesammelt, etwa zur Zuverlässigkeit der standardisierten Untersuchungen sowie zur digitalen Weiterleitung der Daten. Darüber hinaus wird geprüft, wie gut sich das Verfahren in den Praxisbetrieb integrieren lässt und welche organisatorischen Anpassungen notwendig sind.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, ob der telemedizinische Einsatz langfristig helfen kann, regionale Versorgungslücken zu schließen. Das Ergebnis dieses Pilotprojekts wird darüber entscheiden, ob Eyelib künftig in weiteren Praxen und Einrichtungen Anwendung finden könnte. Für die augenoptische und augenärztliche Versorgung in Deutschland könnte dies einen Baustein darstellen, um mit den Herausforderungen des Ärztemangels umzugehen.
Eyelib ist ein Beispiel dafür, wie telemedizinische Verfahren schrittweise in die augenärztliche Versorgung eingeführt werden. Das aktuelle Pilotprojekt wird zeigen, ob sich die Plattform in der Praxis bewährt und in welchem Umfang sie künftig dazu beitragen kann, die Betreuung von Patienten regional zu stärken.